Emotionale Unterrichtsgestaltung
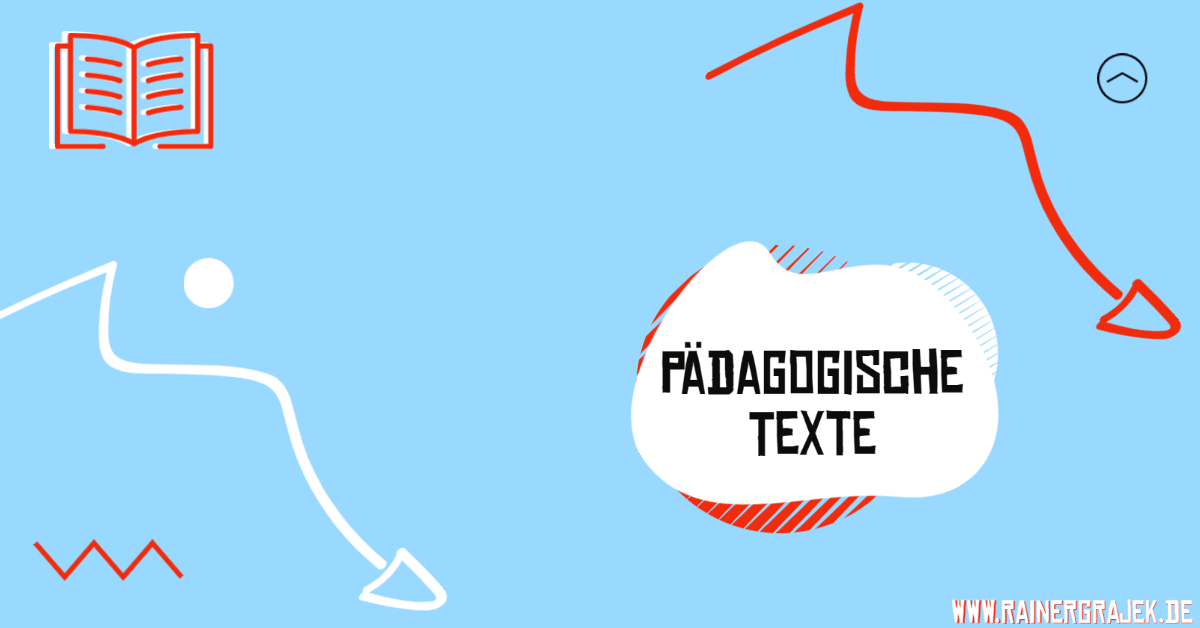
Aus meinen Erfahrungen zur emotionalen Gestaltung der Stunde „Die Unversöhnlichkeit des Klassenwiderspruchs zwischen Bourgeoisie und Arbeiterklasse.“ In: Geschichtsunterricht und Staatsbürgerkunde. 1/78. Volk und Wissen Volkseigener Verlag Berlin 1978. S. 66 – 70.
Aus meinen Erfahrungen zur emotionalen Gestaltung der Stunde 9.1.2.5.: „Die Unversöhnlichkeit des Klassen Widerspruchs zwischen Bourgeoisie und Arbeiterklasse“
Unsere Fachzeitschrift hat mit ihrer im Heft 1/1977 veröffentlichten Diskussionsgrundlage aufgefordert, uns mit folgenden Fragen auseinanderzusetzen:
„Wie gelingt es in unserem Fach, auf der Grundlage exakten und anwendungsbereiten Wissens weltanschauliche Grundpositionen der Schüler zu festigen, die auf ein immer überzeugteres Eintreten für die in den Gesetzen der gesellschaftlichen Entwicklung begründete gerechte Sache der Arbeiterklasse und für die marxistisch-leninistische Politik ihrer Partei gerichtet sind?
Wie schöpfen wir in dieser Grundrichtung die in den Lehrplänen vorgegebenen inhaltlichen Potenzen kontinuierlich und systematisch, lebensverbunden und emotional wirksam aus, und wie führen wir die Schüler in aktiver geistiger Tätigkeit und parteilicher Auseinandersetzung zu den gestellten Unterrichtszielen?“ /1/
Eine Möglichkeit, die sich zur positiven Beantwortung dieser Fragestellungen anbietet, sehe ich in der sich auf der Grundlage einer erkenntnisprozessgerechten Unterrichtsgestaltung vollziehenden Berücksichtigung der Einheit des Rationalen und Emotionalen.
Die von H.-G. Ahnert formulierten Positionen sind m. E. eine wesentliche Hilfe für jeden Staatsbürgerkundelehrer. /2/ Tatsache ist jedoch, dass gegenwärtig noch eine Anzahl von Stunden in unserem Fach sich dem Schüler als „zu trocken“ darstellen, weil sich die Erkenntnisgewinnung zu stark im Allgemein-Abstrakten bewegt.
Es kommt also darauf an,
- auf der Grundlage exakter Kenntnis der Lehrplanziele die Einheit von rationaler und emotionaler Gestaltung immer erfolgreicher zu verwirklichen,
- sich bereits bei der Planung des Unterrichts über die Möglichkeiten der emotionalen Gestaltung Gedanken zu machen.
Denn jeder Pädagoge sollte es als eine wichtige Erziehungsaufgabe ansehen, in jedem Schüler „solche grundlegenden Gefühle wie Freude am Lernen und Freude an der Arbeit zu relativ beständigen und nachhaltigen Gefühlen zu entwickeln“ /3/
Beständige und nachhaltige Gefühlsentwicklung der Schüler erfordert jedoch vom Staatsbürgerkundelehrer, sich langfristig solche methodischen Mittel bereitzustellen, die mit größtmöglicher Sicherheit zu den angestrebten emotionalen Wirkungen führen, denn „ohne emotionale Erfahrung kann man keine Persönlichkeit, nicht nur keine allseitig entwickelte, sondern überhaupt keine Persönlichkeit werden“ /4/
Der Lehrer muss deshalb davon ausgehen, dass Erkenntnisprozess und emotionale Einwirkung einander gegenseitig bedingen, ja, dass sie selbst eine Einheit bilden. Verbinden wir darum die Entwicklung des Emotionalen und des Rationalen im Unterricht eng mit der Lerntätigkeit des Schülers. Rubinstein schreibt dazu:
Da „jeder Vorgang eine bestimmte Beziehung zum Menschen hat und eine bestimmte Einstellung bei ihm hervorruft, kann er in ihm bestimmte Emotionen hervorrufen. Deshalb ist der aktive Zusammenhang zwischen den Emotionen des Menschen und seiner eigentlichen Tätigkeit besonders eng. Die Emotion entsteht notwendigerweise aus der – positiven oder negativen – Beziehung der Resultate des Handelns zu dem Bedürfnis, das sein Motiv, seine ursprüngliche Veranlassung war.“ /5/
Es geht demzufolge darum, die emotionale Einwirkung in den Dienst einer effektiven Unterrichtsgestaltung zu stellen.
Für unser Fach bedeutet das, unser Bemühen ganz besonders auf jene Schwerpunkte zu richten, die für die Erkenntnisgewinnung der Schüler von entscheidender Bedeutung sind.
Auf die Klasse 9 bezogen, hebt R. Bauer hervor:
„Ein neuralgischer Punkt im Hinblick auf die gründlichere wissenschaftliche Fundierung der Einsichten in die Gesetzmäßigkeiten der historischen Mission der Arbeiterklasse besteht nach wie vor in der häufig unzureichenden Sicherheit und Tiefe der Beherrschung des Grundwiderspruchs des Kapitalismus.“ /6/
Ich möchte nun am Beispiel der Stunde 9.1.2.5. (Die Unversöhnlichkeit des Klassenwiderspruchs zwischen Bourgeoisie und Arbeiterklasse) eine Möglichkeit demonstrieren, wie sich die genannten Anforderungen realisieren lassen.
Zum Stundenablauf
Im Stoffverteilungsplan hatte ich dieses Thema als Doppelstunde konzipiert (9.1.2.4.5.).
1. Schritt:
Am Beginn der Stunde 9.1.2.5. stand die Reaktivierung wesentlichen, verallgemeinerten Stoffes aus der Stunde 9.1.2.4. Ausgehend vorn Grundwiderspruch des Kapitalismus (Einsatz der Folie von R. Bauer / G. Hübler) wurde im Unterrichtsgespräch herausgearbeitet:
- Der Grundwiderspruch des Kapitalismus tritt als Klassenwiderspruch zwischen Bourgeoisie und Arbeiterklasse in Erscheinung und äußert sich in der offenen Konfrontation beider Klassen.
- Die Bourgeoisie benutzt den kapitalistischen Staat zur Unterdrückung der Arbeiterklasse und zur Aufrechterhaltung und Verschärfung der Ausbeutung.
- Die Arbeiterklasse kämpft um menschenwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen im Kapitalismus. Sie muss, um sich zu befreien, den Grundwiderspruch des Kapitalismus lösen.
- Der Klassenkampf zwischen Bourgeoisie und Arbeiterklasse verschärft sich ständig.
- Der Klassenwiderspruch zwischen Bourgeoisie und Arbeiterklasse ist unversöhnlich.
Ergänzend fügte ich dem hinzu, dass der Klassenkampf auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens in Erscheinung tritt, dass wir zwischen politischem, ökonomischem und ideologischem Klassenkampf unterscheiden.
2. Schritt:
In der Stunde 9.1.2.4. waren die oben genannten Erkenntnisse durch Beispiele aus der BRD belegt worden. Nunmehr wurde unter Beachtung der Dialektik von Konkretem und Abstraktem im Erkenntnisprozess, in der Zielorientierung auf ein weiteres konkretes Beispiel verwiesen, mit dessen Hilfe der Kampf der Arbeiterklasse „als Kampf gegen kapitalistische Ausbeutung und Unterdrückung“ /8/ exemplarisch gekennzeichnet werden konnte.
Ich formulierte:
Wir wollen in dieser Stunde an einem Beispiel des Kampfes portugiesischer Arbeiter sehen,
- wie sich der Klassenkampf in der gesellschaftlichen Wirklichkeit vollzieht,
- wie die Bourgeoisie den kapitalistischen Staat als ihr Machtinstrument handhabt (innere Funktion des kapitalistischen Staates).
Abschließend wollen wir die Ereignisse werten.
3. Schritt:
Die Schüler erhielten den Auftrag, einen Notizzettel vorzubereiten und in vier Spalten während des nachfolgenden Lehrervortrages Notizen zu folgenden Fragen anzufertigen:
- Welche Absicht verfolgten die Arbeiter der Konfektionsfirma in Braga?
- Welche Maßnahmen leiteten sie ein?
- Wie reagierte die Unternehmensleitung?
- Welche Auswirkungen hatte der Klassenkonflikt zwischen Unternehmer und Arbeitern auf die Produzenten und die Produktion?
- Wie reagierte die Arbeiterklasse?
Ich erklärte, dass es bei dem nun folgenden Beispiel um die Anwendung der im ersten Schritt reaktivierten Kenntnisse und Erkenntnisse ginge. Auf der Grundlage eines leicht bearbeiteten Artikels aus dem „Neuen Deutschland“ trug ich vor:
Zwei Monate lang ging der Name einer großen Bragaer Konfektionsfirma durch die portugiesische Presse: Maconde GmbH. Die in den Benelux-Staaten angesiedelte Gesellschaft mit holländischer Kapitalmehrheit betreibt in Portugals Nordregion noch drei weitere Textilbetriebe und exportiert den größten Teil ihrer Erzeugnisse. Ihr Name ist zum Begriff für Unternehmerfrechheit und zugleich zum Symbol für proletarische Solidarität geworden. Warum?
Für den 7. Oktober hatten Gewerkschaftsdelegierte des Betriebes die rund 600 Beschäftigten zu einem Arbeiterplenum eingeladen. Auf der Tagesordnung sollten Fragen stehen, die mit dem für Januar 1977 vorgesehenen Gewerkschaftskongress verbunden sind. Gegen das Zustandekommen des Kongresses laufen rechtssozialistische Spaltergruppen und Unternehmerverbände erbittert Sturm.
Bevor es zu der Versammlung in Braga kam, erschien am schwarzen Brett des Werkes eine Verlautbarung der Direktion, das Meeting sei nicht gestattet, da die Betriebsleitung „keine Diskussion über diesen Kongress“ wünsche. Die Werktätigen jedoch wiesen den Versuch der Missachtung der portugiesischen Legalität zurück und führten die einberufene Versammlung trotzdem durch.
Die Leitung des Unternehmens antwortete mit einer verfassungswidrigen Maßnahme: der Aussperrung. Am 8. Oktober ließ man zunächst den Strom abschalten, wodurch die Beschäftigten zur Untätigkeit verurteilt wurden. Zugleich scharte die Direktion einige Dutzend ihr ergebener Personen um sich, in deren Namen dann alsbald verkündet wurde, die Arbeit werde nur im Falle der fristlosen Entlassung zweier „für die Störung des Betriebsfriedens“ verantwortlicher Gewerkschaftsfunktionäre wieder aufgenommen. Als der von den Werktätigen angerufene Bezirksbeauftragte des Arbeitsministeriums die Leiter von Maconde zu einem Vermittlungsgespräch in sein Büro bestellte, wurde ihm von Minheer Aerts, dem Manager, schroff bedeutet, er solle sich gefälligst selbst zur Firma bemühen, wenn er etwas wolle.
Bei seinem Eintreffen wurde der Delegat der Lissabonner Behörde zum Zeugen eines direkten Überfalls: Von der Direktion aufgehetzte Elemente suchten die von mehreren Arbeitern verteidigte Gewerkschaftsbeauftragte Gina C. unter Faustschlägen vom Fabrikgelände zu schleppen.
Während die Produktion auch in den folgenden Tagen ruhte, unternahm die Arbeiterklasse alle Anstrengungen, den Konflikt auf vernünftige Weise beizulegen. Nach längeren Debatten sollte schließlich am 13. Oktober der normale Betrieb wieder aufgenommen werden.
An diesem Tag aber fand ein weiterer „Operettenputsch“ statt. Als die rund 400 Ausgesperrten – mehr als 90 Prozent der Belegschaft sind Frauen – gegen 8 Uhr an ihren Arbeitsplätzen erschienen, war von den Ingenieuren, Meistern und Vorarbeitern niemand zu finden. Der vom Unternehmer korrumpierte Belegschaftsteil hatte sich „aus Protest gegen die unerwünschte Rückkehr der beiden Gewerkschaftsfunktionäre“ in der Kantine eingeschlossen und den „Streik“ verkündet.
So sollte es bleiben. Viele Wochen lang. Während die einen ihre Tage im Speisesaal verbummelten, warteten die anderen – arbeitsbereit – an ihren Maschinen. Allein im ersten Stillstandsmonat gingen 130.000 Produktionsstunden verloren. Die Mehrzahl der Beschäftigten erhielt im Oktober und November keinen Lohn. Auf 30 Millionen Escudos bezifferte man schon nach vier Wochen den für Portugal ausgefallenen Exportwert.
Als Unternehmer und örtliche Machtorgane zu der Einsicht gelangten, dass der Widerstandswille und die Klassensolidarität der Arbeiter mit Zermürbungstaktik allein nicht zu brechen sind, entschieden sie sich für eine härtere Variante. Am 9. November erhielt die Bragaer Polizei, deren Personalbestand nach dem Sturz des Faschismus kaum verändert worden war, endlich wieder einmal Gelegenheit, Tuchfühlung mit dem Volk zu nehmen. Als sich die 400 Ausgesperrten zur Stunde des normalen Schichtbeginns – wie jeden Tag – unweit des Betriebes versammelten, um geschlossen die Maconde-Hallen zu betreten, wurden sie bereits von etwa 50 Uniformierten mit gezogenen Schlagstöcken erwartet. Der Polizeiangriff erfolgte sofort und ohne jede vorherige Warnung. Es gab zahlreiche Verletzte. Mehrere Arbeiterinnen – darunter eine im achten Monat schwangere – mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Als es den Frauen schließlich gelang, das Betriebsgelände zu erreichen, wurden sie gezwungen, zu ihrer „Identifizierung“ einzeln am Chef vorüberzugehen. Auf einen Hinweis des Minheer Aerts packten mehrere Polizisten die Gewerkschaftssprecherin Gina C. und brachten sie zum Verhör auf ihr Kommando, von wo sie erst nach dem Eingreifen eines Bragaer Anwalts entlassen wurde.
Die Geschehnisse in der Maconde widerspiegeln den verschärften Klassenkampf im Lande. Fast alle Gewerkschaftsverbände nahmen Stellung. Und noch am Tage der Polizeiattacke von Braga erklang im Parlamentssaal zu Sâo Bento laut und unüberhörbar die Stimme des Proletariats. „Welche Haltung nimmt die Regierung ein, um die Unternehmerherrschaft zum Respekt vor der Verfassung zu zwingen, in der das Versammlungsrecht der Werktätigen verankert ist? Wie steht die Regierung zum Einsatz der Polizei und zur Verhaftung einer Gewerkschaftsbeauftragten?“ hieß es in der Anfrage der PKP-Fraktion.
Die Regierenden, deren Politik den Kurs der kapitalistischen Wiederbelebung auf jede Weise begünstigt, duckten sich einmal mehr weg. Ministerpräsident Mario Soares äußerte, die Auseinandersetzungen bei Maconde seien „ein Konflikt zwischen Patronat und Werktätigen, der ausschließlich von den beteiligten Seiten selbst geklärt werden“ müsse.
Die Bragaer Arbeiterschaft antwortete auf dieses Doppelspiel mit der Verstärkung ihrer im Kampf gewachsenen Solidarität. In mehr als 30 Betrieben wurden Hilfskomitees für die Ausgesperrten gebildet. Zum 14. November beriefen diese – gemeinsam mit allen einflussreichen Gewerkschaftsverbänden des Gebietes – ein großes Meeting ein, dem ein Marsch durch die Hauptstraßen von Braga vorausging.
„Venceremos“ – wir werden siegen! sangen die Arbeiter, als sie am Hallenkomplex der Maconde anlangten. Stürmischer Beifall empfing die Redner der tapferen Belegschaftsmehrheit. Und mit tiefer Bewegung wurde dieses Telegramm aufgenommen: „Wir sind solidarisch mit Eurem Kampf. Es grüßen Euch die Werktätigen des Schwesterbetriebes Herlander in Holland.
In der zweiten Dezemberwoche wurde die Arbeit von allen Beschäftigten wieder aufgenommen. Zuvor hatten Gewerkschaften und Management einen Kompromiss erzielt. Unter Leitung des Zivilgouverneurs von Braga wurde in einem Disziplinarverfahren festgestellt, dass die beiden Gewerkschaftssprecherinnen keine Schuld am Entstehen der zur Aussperrung von Werktätigen führenden Situation hatten. Die Unternehmensleitung musste sich zur Zahlung des Lohnausgleichs verpflichten. Im Testfall Maconde war die Rechnung der Multis nicht aufgegangen. /9/
Da der Lehrervortrag sehr umfangreich war und die Gefahr bestand, dass die Schüler nicht das Wesentliche erfassten und notierten, legte ich nach der Stelle, wo ich über den „Streik“ in der Kantine gesprochen hatte, eine Denkpause ein. Auf die Frage, wie sich die Arbeiter wohl nun weiterhin verhalten würden, äußerten die Schüler Vermutungen. Damit waren sie für den weiterführenden Lehrervortrag wieder „aufgeschlossen“, und ihre Erwartungshaltung war von dem Gedanken „Habe ich richtig vermutet“ bestimmt. So gelang es, die Aufmerksamkeit und das Interesse der Schüler bis zum Ende des Vortrages aufrechtzuerhalten.
4. Schritt:
Nachdem ich meinen Vortrag beendet hatte, ließ ich den Schülern etwas Zeit, damit sie ihre Notizen vervollständigen konnten. Unmittelbar danach – ohne weiteren Kommentar, nur mit einigen kurzen Bemerkungen zum Inhalt – spielte ich das „Grandola-Lied“ vor. Erneut wurde eine kurze Pause eingelegt.
5. Schritt:
Einige Schüler trugen nun vor, was sie sich in den einzelnen Spalten notiert hatten. Bezogen auf die Absichten und Maßnahmen der Arbeiter bei Maconde gab es dabei keine Schwierigkeiten. Die Schüler äußerten dazu, dass es den Arbeitern um die Durchsetzung ihrer gewerkschaftlichen Rechte ging, dass sie auf einem Meeting wichtige Fragen zur Vorbereitung des Gewerkschaftskongresses beraten wollten.
Zur Reaktion der Unternehmensleitung wurde zusammengetragen: Verbot des Meetings, Aussperrung, Entlassung zweier Gewerkschaftsfunktionäre, Überfall auf Gewerkschaftsfunktionär, Streik der Arbeiteraristokratie, Einsatz von Polizei, entwürdigende „Identifizierung“ durch den Chef, Festnahme des Gewerkschaftsfunktionärs.
An Aussagen über die Auswirkungen des Klassenkonflikts auf die Produzenten und die Produktion wurden zusammengetragen:
- Wertvolle Arbeitskraft blieb ungenutzt.
- In einem Monat gingen allein 130.000 Produktionsstunden verloren.
- Die Beschäftigten blieben im Oktober und November ohne Lohn.
- Der ausgefallene Exportwert betrug pro Monat 30 Millionen Escudos.
Zur Reaktion der Arbeiterklasse wurde notiert:
- Die PKP nahm im Parlament Partei für die Bragaer Arbeiter.
- Die Arbeiter der Stadt Braga organisierten Hilfskomitees in 30 Betrieben und führten einen Protestmarsch gegen die Unternehmer durch.
- Die Gewerkschaftsverbände beriefen ein großes Meeting ein.
- Die Arbeiter des Schwesterbetriebes Herlander in Holland übten Solidarität.
Die Schüler verglichen und ergänzten ihre Notizen.
6. Schritt:
Es erfolgte nunmehr die Rückkopplung zur Zielorientierung, verbunden mit der Aufforderung, die Notizen in den vier Spalten noch einmal gründlich zu durchdenken und schriftlich zu werten.
Das Ergebnis sah wie folgt aus:
Zum Handeln der Arbeiter:
- Die Arbeiter gingen klug und entschlossen vor.
- Die Arbeitereinheit ist unbedingte Voraussetzung für den siegreichen Kampf.
- Der Kampf der Arbeiter dieses Betriebes war gerecht. Der Erfolg wird ihren weiteren Kampf beflügeln.
- Die Arbeiterklasse muss, will sie sich befreien, den Grundwiderspruch lösen. Der Klassenwiderspruch ist unversöhnlich.
- Die Arbeiter handelten solidarisch.
Zu den Maßnahmen der Bourgeoisie:
- Die eingeleiteten Maßnahmen dienten der Erhaltung der Macht des Kapitalisten.
- Das Vorgehen war ungerecht.
- Hier beweist sich eindeutig, dass die Staatsmacht im Dienste der Bourgeoisie steht.
- Die Bourgeoisie muss entmachtet werden.
Zu den Auswirkungen des Klassenkonflikts auf die Produzenten und die Produktion:
- Der Kapitalist hemmte die Produktion, indem er die Produzenten aussperrte. Man kann sagen, er hemmte die Produktivkräfte.
- Eine Gesellschaftsordnung, die die Entwicklung der Produktivkräfte hemmt, ist zum Untergang verurteilt. Der Kapitalismus muss beseitigt werden.
Zur Reaktion der Arbeiterklasse:
- Die Kraft der Arbeiterklasse wird durch das organisierte Handeln der Arbeiter unter Führung ihrer Gewerkschaft sichtbar.
- Die PKP tritt für die Interessen der Arbeiter ein.
- Die Organisiertheit und die Solidarität halfen der Arbeiterklasse siegen.
7. Schritt:
In diesem Schritt wurden die Ergebnisse der Stunde eingeordnet und systematisiert.
- Was haben die soeben analysierten Ereignisse von Braga mit dem Grundwiderspruch des Kapitalismus zu tun?
- Wieso beweisen diese Geschehnisse die Unversöhnlichkeit des Klassenwiderspruchs zwischen Bourgeoisie und Arbeiterklasse?
Zum Nachweis des emotionalen Gehaltes der Unterrichtsstunde
Die emotionale Wirkung trat durch folgende Faktoren ein:
- Es wurde ein hochaktuelles Ereignis behandelt, das den Schülern die Möglichkeit bot, auf der Grundlage bereits erworbenen Wissens klar Partei zu nehmen und sich mit den Arbeitern aus Braga zu identifizieren (und damit zu solidarisieren).
- Die dadurch ausgelöste schöpferische Atmosphäre führte zu deutlich wachsendem Erkenntnisinteresse der Schüler. (Tatsächlich verfolgten die Schüler sehr aufmerksam die Veröffentlichungen im „Neuen Deutschland“ sowie die Berichte der „Aktuellen Kamera.)
- Außer der Schallplatte wurden keine weiteren besonders emotionsfördernden Verfahren eingesetzt. Das „Grandola-Lied“ vermittelte den Schülern keine neuen Erkenntnisse, seine emotionale Wirkung an der angegebenen Stelle des Unterrichtsverlaufs war unbestritten. Es beeinflusste wesentlich die nachfolgenden Wertungen der Schüler.
- Es wäre nicht möglich gewesen, die Ereignisse von Braga bereits in der Stunde 9.1.2.4. mit der gleichen Zielstellung einzusetzen. Um analysieren, beweisen, werten und schlussfolgern zu können, benötigen die Schüler exaktes Wissen, wobei der Weg der Erkenntnis vom Konkreten (Stunde 9.1.2.4.) zum Allgemeinen (Stunde 9.1.2.4. und 9.1.2.5.) und von da zum geistig durchdrungenen Konkreten (Stunde 9.1.2.5.) gegangen werden muss.
- Die emotionale Wirkung war während des Lehrervortrages an der Haltung bzw. der Mimik der Schüler ablesbar, so z.B., als vom „Streik“ der Meister, Ingenieure und Vorarbeiter die Rede war, beim Vorgehen der Betriebsleitung und der Polizei gegen die Arbeiter usw. Gefühlsäußerungen wurden sichtbar, Freude (über den Sieg der Arbeiter), Genugtuung (z. B. über die Nachzahlung des Lohnes) und Stolz (über den siegreichen Kampf).
- Die Zielorientierung und die abschließende Rückkopplung ermöglichten eine effektive Schülertätigkeit, dabei wurde vor allem durch die Bestätigung (durch Mitschüler und Lehrer) der Richtigkeit der Wertungen und Schlussfolgerungen Freude an der geistigen Tätigkeit ausgelöst.
- Die angestrebten emotionalen Wirkungen wurden m. E. in der Hauptsache hervorgerufen durch die methodische Gestaltung der Stunde.
Anmerkungen:
/1/ Tieferes Verständnis marxistisch-leninistischer Politik mit Hilfe wachsender Einsicht in die Gesetzmäßigkeit der gesellschaftlichen Entwicklung. Geschichtsunterricht und Staatsbürgerkunde, Berlin 19 (1977) 1, S. 43.
/2/ Vgl. Ahnert, H.-G.: Einige Probleme und Überlegungen zum Emotionalen im Staatsbürgerkundeunterricht. Ebenda, 18 (1976) 2, S. 150ff.; vgl. derselbe: Und nochmals: Zum Emotionalen im Unterricht, Ebenda. 18 (1976) 12, S. 1091 ff.
/3/ Berweg, E.; Henschel. H.: Emotionale Erziehung der Lehrlinge bei der Herausbildung der kommunistischen Einstellung zur Arbeit. Berufsbildung, Berlin 31 (1977) 1, S. 19.
/4/ Klezkin, A.: Haben es die Siebzehnjährigen leicht? Gedanken zu Erziehungsproblemen. Presse der Sowjetunion, (1976) 26. S. 47.
/5/ Rubinstein, S. L.: Grundlagen der allgemeinen Psychologie. Berlin: Volk und Wissen 1960. S. 579.
/6/ Bauer, R.: Ergebnisse, Probleme und Tendenzen der Entwicklung des Faches Staatsbürgerkunde. Geschichtsunterricht und Staatsbürgerkunde. Berlin 19 (1977) 1, S. 11.
/7/ Bauer, R.; Hübler, G.: Folie: Der Grundwiderspruch des Kapitalismus. Folienbeilage. Ebenda, 18 (1976) 8.
/8/ Lehrplan für Staatsbürgerkunde Klasse 9, S. 15.
/9/ Steiniger, K.: Testfall Maconde. Neues Deutschland. Ausg. B, Berlin 31 (1976) 301 v. 18./ 19.12.
Letzte Aktualisierung: 13. September 2020









